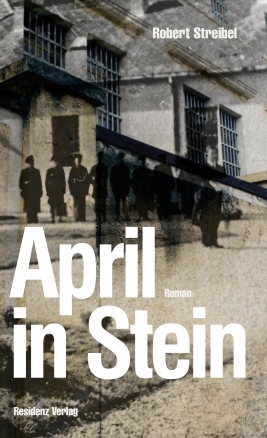Highlights
30. April 2020
Robert Streibel, Wien
Helfen Winterbienen gegen Corona?
Gestern Abend habe ich ein Gegenmittel versucht. Nein, ich habe nicht, wie Trump vorgeschlagen hat, Desinfektionsmittel getrunken, sondern es mit Literatur versucht. „Die Winterbienen“ von Norbert Scheuer. Ein Tagebuch über das Kriegsende, in dem auch Bienen eine Rolle spielen, ist natürlich für mich ein Muss. Es gibt immer etwas, dass noch schlimmer ist als das Jetzt, nämlich der kalte Winter im Februar 1944 und die Bedrohung des entfesselten Wahnsinns der Nazis. Mein Mittel hat fast besser geholfen als ein Whisky.
Aber in der Früh höre ich Crona-Prognosen schon wieder im Morgenjournal und das ist kein Beginn für einen Frühlingstag. Wir werden uns im Freien treffen können, den Sommer über in Maßen, aber im Herbst ist die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Lockdown sehr hoch. Der Bote kann nichts für die Botschaft und die Analyse klingt glaubwürdig.
Da die „Winterbienen“ am Morgen nicht helfen, versuche ich es mit einer Liste. Nicht alles ist nur mehr digital. Ich beginne und muss sofort eine Einschränkung machen, außer meiner Frau ist der Rest der Familie digital, ArbeitskollegInnen gibt es nicht mehr, wenn ich nicht ein paar Schneider der Nähwerkstatt und ihre Helferinnen in der VHS sehen würde, ich wüsste nicht mehr, wie das ist, mit Menschen umzugehen. Es gibt noch eine Gärtnerin vom Verein Gemeinsam im 13 und Günther, den Mann im Hinter- und Vordergrund, zuletzt habe ich sogar eine Kollegin der Bücherei gehört und kurz gesehen. De VHS Hietzing ist sich selbst überlassen. Die Bienen am Dach schert das Virus herzlich wenig, die haben ihr eigenes Virus - die Varroa Milbe -, aber die hat unser Imker gut im Griff. Die Liste mit den digitalen Kontakten ist länger als ich dachte.
Und ich gebe zu, jede Gelegenheit wird von mir genutzt, um nach Kontakten Ausschau zu halten, also Menschen zu beobachten, denn das ist das Einzige, was uns bleibt. Wir gehen uns ja aus dem Weg, und wer sich weiträumiger aus dem Weg geht, ist der bessere Mensch.
Wir leben also in einer sonderbaren Zeit, wo sich gut gekleidete ältere Damen, richtige Ladies mit Kostüm und Schuhen, die fast als High Heels durchgehen könnten, in der passenden Farbe natürlich, die Haare toupiert, als ob der Friseur schon geöffnet hätte, angeregt und nett mit einer Straßenverkäufern, die ohne Schuhe irgendwo bei der Kettenbrücke sitzt, unterhalten, als wären sie bei einem Kaffeeplausch mit Abstand.
Wenn das eine Folge der Krise wäre, das könnte ja fast ein Hoffnungsschimmer sein.
Ich gebe zu: Bis ich mit den ungarischen Obdachlosen plaudere, die sich vor unserem Haus jeden Morgen treffen, muss die Krise noch etwas dauern. Aber so ist das, jeder hat „seinen“ Obdachlosen und die Spargelbauer haben „ihre“ Rumänien.
„Meine Obdachlosen“ sind die von der VHS, sie sehe ich nur mehr selten bis gar nicht. Kein Wunder, unser WC ist nicht benützbar, und der Mann, der üblicherweise bei uns im Straßenbahnhäusl sitzt und ein Bier nach dem anderen trinkt, unser WC benützt und dann beim Hinausgehen mit unserem blauen Fisch im Aquarium spricht, ist jetzt ganz verschwunden. Das Haus ist geschlossen auch für Frau Petrowitsch, die sich jeden Morgen aus dem Humana Container eingekleidet – sie ist eine verkappte Modedesignerin aus Brooklyn, würde ich meinen, wäre da nicht der etwas strenge Geruch. Sie schaut nach unseren Büchern und ruft mit einer schnarrenden Stimme im Foyer nach „Päta“ und sucht ihren Peter. Wenn sie das Haus betritt, rieche ich das oben im 2. Stock. Wann werde ich die „Päta“-Rufende wieder riechen in der Volkshochschule?
Phare du Petit Minou
28. April 2020
Robert Streibel, Wien
Saugen mit Anstand und Würde
Rituale sind der Goldstaub des Alltags. Das Ewiggleiche lässt uns das Zeitgefühl verlieren. Es genügt nicht, am Samstag Semmeln zu essen und am Montag die Woche mit Müsli zu beginnen. Berater und Coaches geben jetzt gute Tipps, wie wir alles besser machen können, damit wir nicht verzweifeln. Wir müssen dem Alltäglichen das Besondere geben. Es braucht aber noch mehr, es braucht eine Inszenierung. Die Hygiene wird jetzt bei uns zu Hause ganz groß geschrieben.
Meine Aufgabe ist das Staubsaugen. Seit einiger Zeit lege ich immer eine CD auf und spiele alle Variationen der Marseillaise. Dann fühle ich mich, als wäre ich im Krieg gegen das Virus. In Frankreich wurde dieser Krieg ausgerufen, in der Zwischenzeit gibt sich der Präsident kleinlaut und würde lieber mit dem kleinen Besen unauffällig Gutes tun wollen. In Frankreich gibt es keine Flotte mehr, aber ich habe immer noch meinen Staubsauger, und jetzt ist es ein beglückendes Gefühl, über den Teppich zu fahren und zu hören, wie die Brösel aufgesaugt werden, dieses Gurgeln wie von einem, der im Nahkampf mit dem Bajonett erledigt wurde. Wenn ich die Bürste abnehme, dann wird das Rohr teuflisch, fast lebensgefährlich für jede Ecke und den Lurch, der dort im Hinterhalt lauert. Heute ist Kampftag, und ein Zimmer muss ich noch befreien, mein Staubsauger wartet schon. „Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons!“ (Zu den Waffen, Bürger, Formiert eure Truppen, Marschieren wir, marschieren wir!)
24. April 2020
Robert Streibel, Wien
Nächstes Jahr in Jerusalem
Ich habe meine Vorsätze gebrochen. Nach einem Tag schon muss ich mir eingestehen, dass das in der jetzigen Zeit nicht möglich ist. Ich meine nicht die Bewegungsarmut, die ein Indikator für die wirkliche Armut sein wird, ein Vorbote sozusagen. Dass ich in der Früh nicht geturnt habe, ist es nicht.
Homeoffice verändert alles, die Grenze zwischen Büro und Freizeit verschwimmt. Das mit der Fünftagewoche, das war einmal, jetzt, wo das Handy alles ist, kann nach dem Radiohören ja auch gleich die Mailbox durchsucht werden.
Mein Vorsatz war aber ein anderer, ich wollte eine Tagebuchpause einlegen. Weil es außer junggrünen Buchenwäldern und grünem Spargel nicht viel zu berichten gibt. Dachte ich. Und dann habe ich gemerkt, dass wir vielleicht in diesen Tagen schneller altern. Das könnte schon sein, denn Sentimentalität ist eine Frage des Alters, und jetzt ist es soweit. Fünf Wochen Quarantäne und uns wird langsam so richtig klar, was das alles zu bedeuten hat.
Als wir im frischen Grün der Buchenwälder Richtung Tulbingerkogel wandern, hören wir den Klassiktreffpunkt, zwei israelische Musiker, Sharon und Ori Kam, interviewt von Albert Hosp, und dann wird Zubin Mehta eingespielt aus New York, er hätte in Wien in diesen Tagen dirigieren sollen. Wann wird er wiederkommen, in ein, zwei Jahren vielleicht? Er meint scherzhaft: Die Koffer sind gepackt. Pessach ist vorbei und am Ende heißt es immer „Nächstes Jahr in Jerusalem“, jetzt bekommt dieser Spruch eine andere Bedeutung, alles ist irgendwie in der Zukunft, und es ist nicht sicher, ob es passiert. Das darf einem auch im frischen Grün Tränen in die Augen zaubern.
Und als ob das nicht genug wäre, bekomme ich dann ein Video, diese Videos sind wie eine Seuche, manche sind witzig, manche tiefgründig, manche gut genug für ein kurzes Lachen. Doch dieses offenbart einen Kern der Ernsthaftigkeit und einer traurigen Fröhlichkeit, spielerisch wird hier das Wesen der Kunst gezeigt und klargemacht, was wir vermissen: Tänzerinnen und Tänzer der Pariser Oper üben und tanzen zu Hause.
So, jetzt ist es geschafft. Nach fünf Wochen liebe ich auch das Ballett. Und wenn die Staatoper mit einem Ballettabend eröffnet würde, das würde uns nicht abhalten, hinzugehen.
Nein Sentimentalität ist keine Frage des Alters, aber beim Konzert für Österreich werde ich trotzdem einige Mal tief durchatmen müssen. Ich hoffe nur, dass die Sängerinnen und Sänger nicht zu jenen gehören – wie Franz Welser-Möst in einem klugen Interview gemeint hat -, deren Agenten jetzt schon höhere Gagen für die Zeit nach Corona verhandeln, während die, ohne die der Betrieb der Oper nicht funktionieren würde, wenn sie Glück haben, nachher gerade noch einen Job haben werden - oder eben nicht.
20. April 2020
Robert Streibel, Wien
Ich habe vom Bundeskanzler geträumt
Heute war die Hölle los. Nein, ich habe nicht vom Vatikan geträumt, aber vom Bundeskanzler. In einer Radiorede, die er komischerweise im Stil der Verkaufsshows gehalten hat, bei denen man Fitnessgeräte oder Uhren oder auch Sexartikel angeboten bekommt, trug er einen weißen Bademantel mit blauem Blumenmuster, das Muster war leicht psychodelisch, der Mantel nicht ganz geschlossen, aber im Traum sieht man ja nicht immer alle Details. Der Inhalt der Rede war besonders, bemerkenswert. Der Bundeskanzler hat ein Gerät vorgeführt, das aus unserem Küchenfundus stammt, eine Kartoffelpresse und mit dieser Presse werde jetzt jedes Essen gemacht, man gebe alles hinein, presse es und könne dann alles sofort essen oder einfrieren. So müssen das jetzt alle Österreicher machen. Es gebe dafür eine Verordnung und deren Einhaltung könne auch kontrolliert werden. Mit den Handydaten.
Ich sollte wohl nicht nur ein Tagebuch, sondern auch ein Traumbuch schreiben. Seine Träume kann sich niemand aussuchen. Dass ich jetzt vom Bundeskanzler auch träumen muss, irritiert mich, stört mich wirklich, vielleicht sollte ich doch den Whisky am Abend nicht absetzen. Entzugserscheinungen machen sich böse bemerkbar. Zum Wohnen gehört auch das Essen. Noch nie wurde so delikat gekocht bei uns zu Hause wie in diesen Tagen. Und wenn man in den Straßen geht, den Mindestabstand einhaltend und die Sprachfetzen von entgegenkommenden Paaren oder überholenden Paaren notierend, so stellt man fest, dass sich das Gespräch sehr oft um den Einkauf oder den Speiseplan für die nächsten Tage dreht.
Und von wegen Kontrolle: Haben Sie auch den Bericht in der ZIB gesehen, wo analysiert wurde, wie sich der Verkehr reduziert habe, die Pendlerströme, alles an Hand der Handydaten? Dieser Bericht blieb vollkommen unkommentiert, es war unglaublich, wieso weiß irgendwer wohin mein Handy unterwegs ist? Niemand hat dies aufgegriffen, das ist offenbar irgendjemandem „passiert“, und kein Aufschrei. Oder habe ich das eventuell auch nur geträumt? Gut. Mehr Crunches am Abend, ich muss die Frequenz erhöhen und dann noch einen Whisky. Und der Bundeskanzler behelligt mich hoffentlich dann nicht mehr.
18. April 2020
Robert Streibel, Wien
Wir leben im Jetzt, und scheinbar hat nur die Kurve eine Geschichte. Diese unbegrenzte Gegenwart hat für manche einen Vorteil. Unsere Gegenwart hat kein Davor. So positiv hat sich die Kirche schon lange nicht mehr präsentiert. Trost, Kraft und was sonst noch alles spendend. Und alles ist vergessen in dieser Gegenwart. Zum Glück ist mein Bücherstapel neben dem Bett umgefallen, es war ein Lottogewinn für meine Erkenntnis: ein Danke an die Schwerkraft.
James Joyce “Ein Porträt des Künstlers als junger Mann“ kam ganz oben zu liegen. Ein Zufall? Wenn die entsprechende Seite aufgeschlagen gewesen wäre, dann wäre das ein Wink (von wem auch immer?) gewesen. So muss ich zu lesen beginnen. Dublin und Stephen Dedalus, die Schule und die Geistlichen. Wer diese Schilderung der Hölle liest, mit der der Prediger die Jugendlichen gepeinigt hatte, der fürchtet sich nicht mehr vor einem Virus. „Das Feuer der Hölle in ewiger Finsternis“, der Gestank, die Schmerzen, das Schreien. Für Stephen als pubertierendem „Sünder“ ist das eine reale Perspektive.
Auch das und noch viel mehr konnte die katholische Kirche und sie kann es noch heute. Die Gegenwart macht uns glauben, dass der religiöse Tag nur aus dem tröstlichen Nachmittagskaffee besteht, doch da war der Morgenruf der Bekehrung und die verschwitzte Mittagsruhe der Jugendlichen jeglichen Alters und dann die Ängste der Nacht.
Die Gegenwart des Virus bringt aber auch anderes zum Vorschein: Die Orthodoxen, seien sie nun Evangelikale, Moslems, Hindus oder Juden, sind die größte Gefahr. Wer glaubt, nur beten hilft, oder auch, den Urin von Kühen zu trinken, und so die Wissenschaft leugnet, ist in jeder Hinsicht eine Bedrohung für die Allgemeinheit. Orthodoxe, vereinigt Euch. Ein Land, in dem alle Orthodoxen glücklich werden sollen, ein Land müssen wir finden, groß genug, schön genug, wo alle Platz finden. Eine Quarantäne erübrigt sich dann.
Der richtige Horror macht kurz vor Mitternacht auch in unserer Wohnung Station. Nach einer Opernaufführung aus Salzburg (1. Reihe fußfrei Fauteuil) sind wir plötzlich im Vatikan und Thielemann dirigiert ein Konzert für den Papst, den Ratzinger. Alle Kardinäle im Publikum mit Ornat, alte Männer, und auf der Bühne ein Bubenchor. Diese Pornografie können weder Mozart noch Mendelssohn entkräften.
Der letzte Schluck des japanischen Whiskys hilft etwas. Ein Geschenk, so kostbar, dass jeder Schluck in einem Buch verzeichnet wurde. Die letzte Eintragung bringt mich wieder auf andere Gedanken und ich schlafe unbehelligt.
16. April 2020
Robert Streibel, Wien
Das Radio im Ohr
In Zeiten der Krise wird Nachrichten hören zum Ritual. Wobei ich gestehen muss, ich habe bei meinem Ritual den Höhepunkt schon überwunden, bei mir ist die Kurve schon abgeflacht, ich bekomme keine Krise, wenn ich die ZIB1 und die ZIB2 nicht sehe und das Abendjournal verpasse.
Um Nachrichten zu hören, braucht es heute kein Radio mehr, und alle Nachrichten sind immer abrufbar.
Ich kannte nur einen Menschen, der wie versessen war auf Nachrichten, immer, wenn es eine Krise gegeben hat, nicht bei uns, sondern in Israel, also fast immer. Bei welchem Nahost-Krieg es gewesen ist, weiß ich nicht mehr, aber Rudi Gelbard, Überlebender aus Theresienstadt und zeitgeschichtlicher Dokumentarist, hatte bei unseren Treffen immer ein kleines Transistorradio bei sich. Rudi war unerbittlich und forderte seine Zeit für Gespräche ein, aber auch für die Nachrichten, gleichgültig, wo er sich gerade befand. Irgendwo in der Nähe des Café Frauenhuber ist es gewesen, er hat seine Aktentasche auf ein Sims gestellt und gemeint, es dauert nicht lange. Hat das Radio ausgepackt und zugehört. Wir sind lange gestanden, er hat gehört und ich habe nur Sprachfetzen mitbekommen.
11. April 2020
Robert Streibel, Wien
Sowas kann nur ein Traum sein
Masken, Virus: alles wie im Krieg. Und ein Kampf gegen einen heimtückischen Gegner. Ich schlafe immer gut, aber seit ein paar Tagen träume ich Fürchterliches. Ich muss keine Moorhühner abschießen, aber irgendwelche anderen Tiere mit Tentakeln. Überleben kann ich nur, wenn ich eine Maske habe. Und dann bekomme ich mitten im Spiel einen Anruf, der Bundeskanzler lässt anrufen, er braucht eine Maske. Ganz dringend, nirgends gebe es welche. Ob ich ihm nicht eine verschaffen könne. Die Nähwerkstatt mit den Flüchtlingen würde doch Masken nähen, habe man ihm gesagt. Das Nähprojekt hat wirklich alles für dieses Spiel, und so liefern die Geflüchteten aus Afghanistan und dem Irak Masken für den Kanzler. Unruhig schüttle ich meinen Kopf und beschließe eine Schlagzeile zu formulieren. „Wie im A… muss eine Regierung sein, die Flüchtlinge nicht will, aber dann braucht, damit sie sicher sind…“ Ich bin nicht fertiggeworden mit dem Formulieren, aber so ähnlich sollte sie lauten. Da ich mich so oft hin und her geworfen habe, werde ich munter, stehe auf, gehe in die Küche und suche mein Handy. Kein Anruf von Kurz: Sowas kann nur ein Traum sein. Oder?
7. April 2020
Robert Streibel, Wien
Wenn die Augen lächeln
An den Augen erkennt man, ob jemand lächelt. Ich bin gespannt, ob ich diese Fertigkeit ausbilden kann. Leider ist es so, dass ich es nie überprüfen werde können. So gesehen, bin ich pessimistisch, denn in unseren Breiten gehört das Lächeln einfach nicht zur Kultur. Es gibt Menschen, die mich herausfordern, bei denen ich mir denke, den oder die möchte ich zum Lächeln bringen, und wenn mir das gelingt, dann wird alles gut.
Gestern war ich auf der Post, dort arbeitet eine nette Person, die auf meiner Aufgabenliste Lächeln ganz oben steht. Bevor ich an die Reihe komme, stehe ich im Freien, das Wetter ist gut, die Warteschlange ist lange, sehr lange. In einer so langen Schlange bin ich das letzte Mal 1978 gestanden, um mich für eine Karajan-Aufführung des „Troubadour“ anzustellen, natürlich mit dem kleinen Unterschied, dass die Menschen damals dicht gedrängt waren.
Ich habe Zeit, mich vorzubereiten: Werde ich es heute schaffen? Nicht eine Stehplatzkarte zu ergattern, sondern die Postbeamtin zum Lächeln zu bringen. Ich habe viele Pakete. Das ist der zweite Tag, an dem ich mit vielen Paketen komm. Seitdem ich für die Grätzlbuchhandlung in Lainz die Pakete zur Post bringen darf – Nachbarschaftshilfe –, falle ich auf. Sonst habe ich nur Briefe.
Heute ist ein besonderer Tag, denn heute sind endlich die Schutzmasken geliefert worden, ab morgen werden sie getragen – ich höre, wie die beiden Postlerinnen unterhalten. Heute ist also der letzte Tag, wenn ich es heute schaffe, dann weiß ich, wie sich die Augen verändern beim Lächeln.
Nicht alle Adressen sind schön leserlich geschrieben gewesen auf den Paketen, als sie bei einer Adresse nachfragt, mache ich einen Witz, er war, glaube ich, nicht gut, eigentlich kein Witz, als Entschuldigung gedacht, irgendwie halt… und da ist es passiert. Es war ein kurzer Anflug eines Lächelns.
Ab morgen werden wir alle Masken tragen, doch alles wird gut, denn ich erkenne jetzt hinter allem Stoff und Papier das Lächeln.
4. April 2020
Robert Streibel, Wien
Der Onegin vom Flötzersteig
Was wir jetzt alles digital tun sollen, Sprachen lernen, Museen besuchen, Opernaufführungen betrachten, und dann noch klatschen und singen und das wiederum digital vorführen. Wenig von all dem tue ich, eigentlich bleibt keine Zeit dafür, oder ich will sie mir nicht nehmen. Doch den „Eugen Onegin“ habe ich gesehen, am Flötzersteig. Dort ist kein Opernhaus, dort lebt aber ein 90-jähriger Mann, der in diesen Tagen seinen Geburtstag feierte. Eine Familienfeier war nicht möglich. Die Kinder haben ihm zwei Sänger gebucht und einen Klavierspieler dazu. Alle standen im Abstand von zwei Metern und so wurde eine Arie aus dem Onegin gesungen und russische Volkslieder. Es war fast so kalt wie in Russland, wohin es den Mann durch die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts verschlagen hatte. Er liebt die russische Musik bis heute.
1. April 2020
Robert Streibel, Wien
Die Drohnen sollen fliegen
Heute ist der 1. April. Jedes Jahr überlege ich lange, welche Meldung ich in diesem Jahr absetzen werde.
Innenministerium bestellt 2000 Drohnen in der VHS Hietzing
Ökologische Überwachung auf Straßen und Bars.
Das Bienenkompetenzzentrum der VHS Hietzing freut sich über einen besonderen Auftrag. Vor wenigen Tagen bekam Thomas Hager, der Imker, der unter anderem auch die Bienenstöcke auf dem Dach der VHS Hietzing betreut, einen Anruf aus dem Innenministerium.
Da bei Einsetzen des Frühlingswetters die Überwachung der Ausgangsregeln durch die Polizei nicht mehr in dem Ausmaß gewährleistet werden kann, möchte das Ministerium alle Maßnahmen ausschöpfen. Da Ökologie und Effizienz ganz großgeschrieben werden, sollen nun Drohnen eingesetzt werden.
Der Vorteil dieser Überwachungs-Bienen ist, dass sie flexibel auf der Straße wie auch in Gebäuden und Gasthäusern und Bars einsetzbar sind. Selbst in Innenhöfe können sie pfuschenden Friseuren folgen. Auf der Unterseite sind die Drohnen mit einer Minikamera ausgestattet, die akzeptable Fotos in Livequalität liefert.
Ob der erste Einsatz in Hietzing am 1. April erfolgen kann ist, noch nicht entschieden, da bisher noch nicht geklärt werden konnte, ob die Drohnen auch offiziell angelobt werden müssen. Der Bundespräsident übt zurzeit den entsprechenden Schwänzeltanz, der dann mit Videoschaltung auf das Dach der VHS übertragen wird.
„Wir sind in den Startlöchern“, meint Thomas Hager mit seinen 2000 Drohnen, die in Kürze in Aktion treten werden. Dass diese Drohnen-Aktion für ganz Österreich in Hietzing begonnen wird, ist für den Direktor der VHS Hietzing Prof. Dr. Robert Streibel eine Selbstverständlichkeit. „Die ersten Fälle der Spanischen Grippe im Juli 1918 wurden in Hietzing registriert, wie die Zeitungen damals berichtet haben. Daher haben wir eine historische Verpflichtung.“
31. März 2020
Robert Streibel, Wien
Ich fahr auf Urlaub ins Jahr 1918
Ich will ein bisschen Urlaub vom Hausarrest, von den täglichen Sondersendungen nehmen. Wegfahren ist nicht möglich, manche Länder werde ich so schnell nicht bereisen. Aber auch das Inland ist gefährlicher als ein Dschungel. Also wieder abtauchen in die Geschichte, das hilft, denke ich. Aber diesmal Geschichte ohne Ansteckungsgefahr: die Spanische Grippe 1918. Alles überstanden. 25 Millionen Tote, keinen davon kenne ich. Das beruhigt auch nicht.
Alles war schon einmal da. Auch die Fake News. Als die ersten Berichte über die Spanische Grippe in den Wiener Zeitungen erscheinen, wird im Juni 1918 die Vermutung angestellt, dass deutsche Giftgase für die Verbreitung der Influenza in Paris ausschlaggebend seien. Der Wind.
Ein Monat später die ersten Fälle in Wien. „Auch in Wien tritt die eigenartige Krankheit auf.“ Wo? Im 13. Bezirk werden einige Fälle berichtet. Lokalpatriotismus?
Die Medien und die Seuche. Eine Symbiose. „Schicken Sie uns bitte Fotos, aber im Querformat.“ Nicht von Patienten, die beatmet werden, sondern von den mit einem Eispanzer überzogenen Marillenblüten, meint die Moderatorin des Wetters im ORF, als sie die dritte Eisnacht ansagt und über den Kampf dagegen berichten will.
Die Medienbranche verformt das Denken. Als ich mein Urlaubsziel im Jahr 1918 gewählt habe, habe ich mir noch gedacht: So viele Meldungen, wie ich in der ANNO Datenbank der Nationalbibliothek in den Zeitungen finde, so viele Infizierte in Österreich. Wenige Stunden später: Ich war enttäuscht, für diesen Gag bin ich zu spät auf „Urlaub“ gefahren. 1044 Meldungen. Das hatten wir schon vor Tagen erreicht. Heute sind es über 9000.
30. März 2020
Robert Streibel, Wien
Ungeöffnete Briefe
Wer jetzt keinen Hund hat oder kein Kind an der Hand, der wird sich bald rechtfertigen müssen. Die meisten Menschen dürfen nur kurz hinaus, die Bauarbeiter müssen lange hinaus. Wie sich die Bedeutung von dürfen und müssen verändern.
Auf meinem Weg mit dem Rad in die geschlossene Volkshochschule begegne ich jeden Morgen einer Frau mit ihrem Rollator, jeden Tag wächst der Abstand zu ihrer Betreuerin. Am Abend in den Nachrichten werden die Fieberkurven gezeigt, die Zahl der Infizierten. Sinkt die Kurve? Flacht sie ab? Bei Aktienkursen würden sich manche das exponentielle Wachstum wünschen. Die Kurve entscheidet über den Hausarrest, über Arbeitsplätze, über das Leben, und weil wir Menschen sind, denken wir auch an die Oper, an den Urlaub. Wird es das alles danach noch geben? Und wann?
Damit wir nicht vereinsamen, gibt es viele Lösungen, so viele Angebote, dass ich fast Fieber bekomme. Was ich jetzt alles sehen und besuchen sollte und dann auch noch klatschen und musizieren. Ich packe mein Leben und meine Projekte in Schachteln. Dinge zu tun, zu denen ich sonst nicht komme, ein Segen, aber auch ein Fluch, ich kämpfe mit meiner Unzulänglichkeit als Archivar. Was ich alles finde, eine Freude, aber gleichzeitig bin ich wütend, warum habe ich nicht alle Fotos der aus Hietzing stammenden Jüdinnen und Juden, die ich in Amerika besucht habe, ordentlich beschriftet? Und dann schwelge ich in Erinnerungen, zum Beispiel an Michael Kehlmann, dem begnadeten Regisseur für Film und Fernsehen. Im Jahr 2000 haben wir ihm ein kleines Symposium gewidmet. Und dann bei dem Versuch, Schwarzwaldtage in Aussee zu organisieren, hat er für einen kleinen Kreis gesprochen und sein Sohn Daniel war damals auch gekommen und hat über Karl Kraus referiert. Alles findet sich, und gerade hat Daniel Kehlmann die neue Karl Kraus Biographie besprochen. Es gibt keine Zufälle.
Jetzt wird viel über die Schwierigkeiten der Kommunikation gesprochen, zumindest das Telefon funktioniert. Helfen Telefonate gegen die Vereinsamung oder beruhigen sie nur das Gewissen? In meinem Alltag stoße ich in diesen Tagen auf Kommunikationsfehler, die mehr schmerzen als ein Hausarrest ohne Fußfessel. Ich habe beim Aufräumen Briefe gefunden - so ist das, werden Sie sagen. Aber ungeöffnete Briefe! Und es waren keine Mahnungen und keine Vorschreibungen eines Amtes. Am schlimmsten ist es, wenn die Absenderin bereits tot ist, und ihr Brief vor zehn Jahren abgeschickt wurde. Ich bringe es nicht fertig, den Namen zu nennen. Eine Schwarzwaldschülerin war es, mehrmals war ich bei ihr zu Gast, mit fortschreitendem Alter wurde sie wunderlich, man könnte auch sagen, ein wenig anstrengend. Ihre Liebe zu Eugenie hat sie zur Stalkerin gemacht und so hat sie mich öfter angerufen, das Gespräch habe ich nicht verweigert, aber so unvorbereitet, so im Alltag… kann das etwas anstrengend sein.
Merken Sie es: Ich versuche meinen Fehler kleinzureden, Ausreden wie Türsteher zu postieren, damit Sie nicht bis zur Wahrheit vordringen. Es war nicht der einzige ungeöffnete Brief. Vielleicht war es auch ihre katholische Betulichkeit, die mich immer in eine gewissen Unruhe versetzt hat. Jetzt im Hausarrest öffne ich den Brief. Seit vielen Jahren ist sie tot, ihr Haus ist geräumt, und sie spricht in diesem Brief eine Einladung aus, die ich nie mehr einlösen werde können, ich soll wieder vorbeikommen und sie besuchen, sie habe mir noch so viel über die Sekretärin von Fraudoktor von Mariedl, von Marie Stiassny, zu erzählen. Keine Chance mehr. Alles zu spät. Verzweifelt habe ich nach mehr Details über sie vor einiger Zeit gesucht.
Mir wird heiß und kalt, Fieber ist es nicht. Scham ist nicht ansteckend, wenn es auch so etwas wie fremdschämen gibt. Jedes Gespräch könnte das letzte sein, und lassen Sie Briefe nicht ungeöffnet, doch wer schreibt heute überhaupt noch Briefe?
Und kurze Zeit später dann eine E-Mail von einem Bekannten aus Dänemark, er hat in der ZEIT eine Buchbesprechung von Elisabeth von Thadden über das Buch von Eva Weisweiler. „Echo deiner Frage. Dora und Walter Benjamin. Biographie einer Beziehung“ gelesen. Die hier zitierte Formulierung von Dora Kellner über Eugenie Schwarzwald, das sei doch eine Ungeheuerlichkeit, das kann doch nur eine Verwechslung sein.
Ich will mich nicht nochmals an diesem Tag schuldig machen. Schreibe sofort an die ZEIT und dann an den Verlag. Leider könnte ich mir das Buch jetzt nicht besorgen, da alle Buchhandlungen geschlossen sind. Am nächsten Tag die Antwort der Autorin: „Warum Dora noch 1938 an Walter Benjamin geschrieben hat: "Die Akten über Genia Schwarzwald sind nun geschlossen. Sie ist und bleibt ein infames Luder, wird niemandem mehr nützen, aber hoffentlich auch niemandem mehr schaden." So eine scharfe Ausdrucksweise ist atypisch für Dora, ebenso wie die Tatsache, dass sie keinerlei Mitleid zeigte, als ihre alte Lehrerin von den Nationalsozialisten ruiniert wurde. Dies kann nur durch außergewöhnliche Vorkommnisse zu erklären sein.“
Die Kommunikation funktioniert und gibt Rätsel auf, nach so vielen Jahren. Wir glauben alles zu wissen über eine Person.
Bei Petra Hartlieb bestelle ich am Nachmittag das Buch online, sonst hätte ich natürlich in der Buchhandlung meines Vertrauens, in der Grätzlbuchhandlung in Lainz, gekauft. Werbung kann nicht schaden. In diesen Zeiten.
27. März 2020
Robert Streibel, Wien
Nichts ist so, wie es einmal war. Positiv sein ist doch wichtig. Wer positiv denkt, lebt länger, wenn er lachen kann und dies auch tut. Da schreibt mir ein Freund, er sei positiv, zum Glück nur leicht positiv, und in den nächsten 14 Tage zu Hause. Positiv, das ist also nicht gut. Sind Optimisten also negativ? In meinem Büro hängt ein Plakat von Heiner Müller und der Unterschrift: „Vorsicht Optimist“. Heiner Müller ist schon tot. Ein Optimist eben.
Aber ist jetzt wirklich alles anders? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Positiv war nie gut. Das habe ich schon beim Bundesheer Ende der achtziger Jahre erfahren können. Da ich schreiben konnte, kam ich in die Schreibstube, und mein Unteroffizier war so nebenbei auch für die Sicherheit zuständig. Nach drei, vier Wochen Dienst musste ich ein Fax holen und ihm auf den Schreibtisch legen. Ich habe es gelesen – am Gang zum Büro. 12 Mann negativ, einer positiv. Eine halbe Stunde später wurde ich in die Küche versetzt. Da wusste ich, ich bin positiv. Meine linken Umtriebe waren offenbar aktenkundig.
Positiv, negativ. Eben alles relativ.
22. März 2020
Robert Streibel, Wien
Ich bin ein Verdrängungsweltmeister
In meinem Büro ist ein Gedränge, atemberaubend, manchmal bekomme ich fast keine Luft. Der geforderte Meter Abstand ist unmöglich einzuhalten. Nie habe ich es geschafft, ihnen den notwendigen Raum dazwischen zu lassen, jetzt wäre es nötig. Aber ich kann keine Rücksicht nehmen auf alle Empfehlungen. Wenn ich alle Lampen einschalte, ist es besser. Neben mir, hinter mir, vor mir, sie kommen mir ganz nahe.
Bevor jetzt irgendwer im Innenministerium meine Adresse trackt, wie das so schön heißt, um zu überprüfen, ob ich eine illegale Veranstaltung abhalte, gleich hier eine Klarstellung. Ich halte mich an alle Vorschriften und bin zu Hause. Home office. Ein Privileg und trotzdem ist alles überfüllt. In Zeiten wie diesen darf man sich nicht spielen, daher kommt die Klarstellung bereits an dieser Stelle.
Wenn ich Sie im Unklaren gelassen hätte und das Rätsel später gelüftet hätte, wäre das literarisch sicherlich spannender. Sonst hätten sie jetzt die Vorstellung von einem bis auf den letzten Platz gefüllten Raum, überall sind sie, auf den Sesseln, auf dem Schreibtisch, überall, wo nur irgendein Platz ist, sind sie zu finden. Nein, das ist keine Studenten WG, alles geht gesittet ab, kein Durcheinander. Wenn ich aufstehe, kann ich mich trotzdem im Raum bewegen, ohne an irgendjemandem anzustreifen. So viele sind da, sie sind nicht gekommen, sie sind da, in jedem Jahr werden es mehr, sie gehen nicht heim, wohin sollten sie auch gehen? Einmal eingeladen, sind sie da und verschwinden nicht, manche verdrücken sich in eine Ecke, manche auch in Schachteln. So viele, so dicht gedrängt und keine Tröpfcheninfektion. Keine Gefahr also. Die Erinnerung nässt nicht.
Durch die neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind wir gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ein Privileg, dass der Billa-Kassiererin nicht gegönnt ist. Von zu Hause zu arbeiten heißt auch, auf sich zurückgeworfen sein, allein gelassen mit all der Geschichte, mit all den Geschichten, mit all den Personen, die ich in den letzten zwanzig, dreißig Jahren angesammelt habe. Keiner verschwindet, alle sind da. Die Toten aus Stein sind zu meinen Füßen, sie haben es schon in Schachteln geschafft, Eugenie Schwarzwald und ihre Schülerinnen, die sind noch in Ordnern, sie wehren sich ein wenig, abgelegt zu werden. Der Zweigelt liegt verstreut in mehreren Dokumenten herum, dazwischen noch der Peter Handke von der letzten Marathonlesung und überall Nazis: Brutale und harmlose. Die letzten, die sich bei mir eingenistet haben, sind die beiden Bombenattentäter von Krems, vom Juni 1933.
Zu Hause zu arbeiten ist schön, aber es zwingt zu einem besonderen Verhalten: Zur Ablage. Niemand macht heute mehr Ablage, denn alles ist elektronisch, wer hat noch Zetteln? Meine Ablage ist mein Archiv und das ordne ich jetzt.
Ich bin ein Verdrängungsweltmeister, kein Wunder, ich habe von den besten gelernt als Historiker, der sich auch mit dem „Umgang“ mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe meine Geschichte. Ich kann mich in die Geschichte zurückziehen, von der Arbeitslosigkeit der 30er Jahre lesen und dabei die aktuelle Situation vergessen. Ich muss nicht trauern, denn die, die um mich sind, sind alle schon tot.
Die Geschichte hat einen großen Vorteil. Wer sie studiert, ist klüger, der weiß, wie es ausgeht, der weiß, was passiert ist. Mit dem Leben verhält es sich da etwas anders. Wir sind auf uns zurückgeworfen. In der Welt passiert außer dem Virus scheinbar nichts mehr.
Mein Vater, der weiß, wer in welchem entscheidenden Fußballspiel das Tor geschossen hat, weiß jetzt, wie viele Infizierte es heute sind, um 31% mehr als gestern. Ich bin gespannt, wie die Zahlen am Abend sind.
Morgen packe ich Hans Georg Friedmann in eine Schachtel. Der dreizehnjährige Bub aus Hietzing hat bis zu seiner Deportation Krimis geschrieben. Er hat sich einen Helden erfunden. Tom Lasker. Die Krimis hat die Haushälterin aufgehoben, sie haben den Krieg überlebt.
Manche meinen, wir befinden uns jetzt im Krieg. In der Abenddämmerung fliegen die ersten Fledermäuse dieses Jahres vor unserem Fenster. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll.